
# 9 | Gleichzeit
Briefwechsel
In der Reihe „Gleichzeit“ schreiben Sasha Marianna Salzmann und Ofer Waldman in insgesamt zehn Beiträgen über ihre ganz persönlichen Eindrücke, Erfahrungen und Beobachtungen in den Wochen nach dem Terroranschlag vom 7. Oktober. Ein literarischer Dialog zwischen Israel und Mitteleuropa.
Ofer an Sasha, 20. Dezember 2023
Jerusalem, vor wenigen Jahren. Mein Vater, meine Mutter und ich stehen auf dem Gelände des deutschen Krankenhauses Augusta Viktoria, an dem Ort, wo bis 1967 die Grenze zwischen der israelischen Enklave des Mount Skopus und dem arabischen Ostjerusalem verlief. Augusta Viktoria ist einer der höchstgelegenen Punkte Jerusalems, die Aussicht von hier ist in fast alle Richtungen unverstellt: Westlich von uns liegt die Jerusalemer Altstadt, die jüdische Weststadt, dahinter erahnt man grüne, bewaldete Berge und Hügel, Tel Aviv, das Mittelmeer. Östlich von uns erstreckt sich die weiche judäische Wüstenlandschaft, Beduinenzelte, palästinensische Dörfer, israelische Siedlungen, Jericho, das Tote Meer. Mein Vater hat hier 1967 gekämpft, wir stehen hier, weil ich einen Radiobeitrag über ihn und mich mache, zwei Jerusalemer im Gespräch, zwei Generationen. Über das kleine Vor-1967-Israel, das mit dem noch glühenden europäischen Abgrund im Rücken an dem Abgrund des unaufhörlichen Krieges ums Überleben stand. Über das große Nach-1967-Israel, die selbstbewusste Besatzungsmacht, in die ich hineingeboren wurde, die mich zunehmend befremdete. Ein Israel, das vielleicht auch weiter weg von den vielen Abgründen lag, die um meinen Vater klafften. Weiter weg, das heißt auch: Dort, wo ein anderer Horizont möglich, wo andere Zukünfte vorstellbar waren.
Mein Vater erzählt, dass während der angespannten Zeit um den Krieg alle wehrfähigen Männer eingezogen waren und in Uniform und mit Waffen herumliefen. Dass es eine Schande war, sich als junger Mann ohne Waffe und Uniform auf der Straße zu zeigen. Das waren aber andere Zeiten, sagt mein Vater. Ja, andere Zeiten, pflichtet ihm meine Mutter bei, und ich murmle, wie als Echo, ja, andere Zeiten.
Auf dem Weg zurück zum Auto wird meine Mutter sagen, dieser Ort hier sei eine Wasserscheide. Jeder Tropfen Regen, der hier fällt, teilt sich in zwei Hälften, die zwei miteinander unversöhnliche Verläufe nehmen. Eine Hälfte gesellt sich zu den westlich von hier niederprasselnden Tropfen und bahnt sich als Teil von ihnen den Weg über Berge und durch Täler ins Mittelmeer. Die andere Hälfte verdampft in der Wüstenhitze oder sickert in die Erde, um dann, überraschend, am Fuße eines Wüstenhügels oder im Jordantal als Quelle aus der Erde zu brechen.
Vor zwei Wochen bin ich auf eine Shiva gegangen. Yuval K., der Sohn eines Nachbarn, ist bei einem Anschlag in Jerusalem ums Leben gekommen. Es hat sich so zugetragen: Zwei Terroristen der Hamas drangen nach West-Jerusalem ein, stiegen an einer Haltestelle am Stadtausgang aus ihrem Auto und fingen an, auf Passanten zu schießen. Yuval, der zufällig in diesem Moment dort vorbeifuhr und eine Pistole bei sich trug, hielt an, sprang aus seinem Auto und erschoss die beiden. Zwei Soldaten, die in der Nähe waren, eilten ebenfalls zum Tatort. Yuval, der keine Uniform trug, begriff, dass die Soldaten ihn ebenfalls für einen Terroristen halten könnten. Er sank auf die Knie, warf die Pistole weg, zog seine Jacke hoch (um zu zeigen, dass er keinen Sprengstoffgürtel trug), hob seine Hände und schrie: Nicht schießen, ich bin Israeli! Das half ihm alles nicht. Die Soldaten erkannten ihn nicht als einen der ihren und schossen so lange auf ihn, bis er regungslos am Boden lag, tödlich verwundet.
Ich kenne Yuval K.´s Vater nicht persönlich, deshalb habe ich mich mit einigen Nachbarinnen vor dem Haus verabredet, um mit ihnen zusammen auf die Shiva zu gehen. Ich gehe langsam unsere Straße hinunter, bis ich das kleine, von der Stadtverwaltung aufgestellte Schild sehe, auf dem in dicken schwarzen Buchstaben steht: „Zur Schiva der Familie K.“, darunter ein Pfeil und Zeitangaben, wann Besuch erwünscht sei. Es ist noch vor der verabredeten Zeit, ich traue mich nicht, direkt am Hauseingang zu warten, also gehe ich auf die andere Straßenseite, von wo aus ich die vielen Besucher*innen der Shiva beobachten kann. Ich erkenne sie schon von Weitem an ihrem langsamen Schritt, an einer bestimmten Schwere des Gangs, als ob sie sich durch Wasser bewegen müssten. An der kurzen Pause, die sie sich gewähren, bevor sie das Haus betreten. Viele von ihnen mit umgehängten Gewehren, einige in Uniform, andere in Zivil. Auch als meine Nachbarinnen kommen, unterhalten wir uns noch kurz, reden belanglose Sätze, um Mut zu sammeln, bevor wir über die Türschwelle gehen.
Yuval K.´s Vater ist religiös, nicht streng, aber so, dass die wenigen schlichten Dekorationen an den Wänden und im Bücherregal im Wohnzimmer jüdische Motive zeigen, Davidsterne, hebräische Schriften, einen betenden Rabbi. An eine Wand gerückt steht ein Tisch mit billigem Saft, Plastikbechern und aufgerissenen Schokokeksverpackungen. Zahlreiche Kinder, von einem tatkräftigen Onkel dirigiert, schwirren durch das Haus und in den Garten, schlängeln sich um die Beine der Gäste, um die stählernen Läufe ihrer Gewehre, tragen weiße Plastikstühle und Kaffeetassen, leeren Aschenbecher, ihr Gesichtsausdruck vom ausgesetzten Normalgang des Lebens, von ihrer Rolle darin gezeichnet, ihre Augen aufgerissen.
Ich gehe zuerst in den Garten. Auch hier Plastiktische und -stühle, das Rauschen leiser Gespräche, die vom Donner vorbeifliegender Kampfjets kurz gestört werden, um dann wieder ihren Fluss aufzunehmen. Wir setzen uns an einen Tisch, verlegen, reden weiter belangloses Zeug, eine Nachbarin vergisst sich und lacht, ich schaue weg, sehe einen alten Freund aus Jerusalem. Wir stehen beide auf, er schwingt sein Gewehr auf den Rücken und umarmt mich, ich muss nichts auf den Rücken schwingen. Ich nütze die Gelegenheit, kehre nicht zu meiner Gruppe zurück, gehe stattdessen ins Wohnzimmer und setze mich in den Stuhlkreis. Der Vater von Yuval K., mein Nachbar, hält sich sein Handy vors Gesicht, offenbar macht er gerade einen Video-Check für ein Interview, das er später geben soll. Auf seinem Gesicht graue kurze Bartstoppel, auch schwebt eine Art leises, erstarrtes Lächeln über seinen Lippen, seine Hand fasst unbewusst immer wieder nach der Kippa auf seinem Kopf, lässt sie ein wenig hin und her über das dünne Kopfhaar gleiten. Der Check ist beendet, er legt das Handy weg und beginnt zu reden, er erzählt die Geschichte vom Tod seines Sohnes. Offenbar macht er es seit Tagen, in Dauerschleife, setzt an einem beliebigen Punkt ein (Die gehobenen Hände Das zufällige Vorbeifahren Die weggeworfene Pistole Die hochgezogene Jacke Der Soldat Jerusalem Der Schuss Ich bin) und erzählt weiter, bis er wieder von einem Anruf oder von einem Gast im Redefluss gestört wird, seinen Blick kurz hebt, wobei das erstarrte Lächeln seine Lippen zu zwei dünnen Linien zieht. Der Stuhlkreis atmet Menschen ein und aus, die ankommenden setzen sich für eine Weile hin, warten, bis sie einmal alle Bruchstücke der Geschichte gehört haben, stehen langsam auf, warten kurz (wie vor dem Haus), gehen zu meinem Nachbar, nehmen seine Hand, murmeln die eingeübten Worte, gehen dann hastig aus dem Kreis, aus dem Haus, verblassen im Licht der Tür.
Zwei Ultraorthodoxe, schwarz gekleidet, ein fülliger und ein schmaler, treten laut redend in den Kreis, ich werde sauer, denke, sie wollen hier predigen oder für irgendwas werben. Sie setzen sich, schauen in die Runde, studieren die Anwesenden mit geübten Blicken, der Füllige fängt an, laut zu erzählen, „wir sind von einer Wohlfahrtsorganisation“, sagt er, ich kralle mich fest an meinem Plastikstuhl, jetzt kommt´s, denke ich. „Ich komme gerade vom Hadassah-Krankenhaus in Jerusalem“, redet er weiter (Yuval K.´s Vater schickt eine Hand zur Kippa, der schmale Ultraorthodoxe macht es ihm nach). „Dort liegt ein Verwundeter vom Anschlag, ich und mein Freund hier“, sagt der Füllige und weist mit dem Kinn zum Schmalen hin, „ich und mein Freund hier haben ihn gefragt: Bruder, was können wir machen, Bruder, wie können wir helfen?“ Der Füllige macht eine kurze Pause, schaut wieder in die Runde, nicht alle schauen ihn an, keiner redet außer ihm, er gibt sich damit zufrieden und erzählt weiter. „,Fahrt nach Tivon‘, sagte der Verwundete, ,fahrt nach Tivon zum Vater von Yuval und sagt ihm, sagt ihm, sein Sohn hat mein Leben gerettet.‘“
Das Handy von Yuval K.´s Vater klingelt, wieder muss er es vor sein Gesicht halten, ein neuer Check. Als dieser vorbei ist, fängt der Füllige doch an, etwas aus den Schriften zu predigen, die anderen im Stuhlkreis drehen ihre Köpfe weg, einige reden miteinander, er reibt sich die Hände und verstummt.
Der Kreis hat wieder Menschen eingeatmet, wird voll, ich will aufstehen und mich verabschieden (ich habe mich für ein schlichtes „Möge euch der Ort trösten“ als Abschied entschieden), werde dann von meinem Sitznachbar angesprochen.
„Bist du ein Freund der Familie?“, fragt er.
„Nein, ein Nachbar, ich wohne gleich hier, fünf Minuten entfernt. Und du?“
„Ich?“, fragt der andere, den ich nicht wiedererkenne, er kommt also nicht aus unserer Nachbarschaft.
„Ja, bist du ein Freund der Familie, ein Kollege?“
„Nein, nein“, sagt er. „Ich, ich bin einfach vom Volk.“
Dazu sage ich nichts, stehe auf, trete an den Vater von Yuval K. heran, nehme seine weiche Hand in meine Hände, murmle meinen eingeübten Satz, schlängle mich zwischen den stählernen Läufen der vielen Gewehre hindurch und verschwinde hastig, ohne mich von meinen Nachbarinnen oder meinem Kindheitsfreund zu verabschieden.
Auf dem Weg nach Hause denke ich an Dich, Sasha, an uns. An unsere Gespräche, unsere Briefe. Und daran, dass meine Mutter sich irrte. Die Wasserscheide ist eine Illusion. Egal, wohin und wann wir fallen, es blickt uns immer ein Abgrund entgegen.
Sasha an Ofer, irgendwann um Weihnachten
Eine der für mich wichtigsten ukrainischen Dramatikerinnen unserer Zeit, Anastasiia Kosodii, schrieb nur wenige Monate nach der Kriegsausweitung in ihrem Land ein Theaterstück mit dem Titel Eight Short Compositions on the Lives of Ukrainians for a Western Audience. Es ist eine Collage aus Dialogen, Berichten, Flashbacks der Flucht vor der russischen Armee und TikTok-Videos. Eines davon ist mir nachdrücklich in Erinnerung geblieben: Kharkov birds have learned to imitate the sound of Russian Kalibr missiles. Darin sitzen Vögel (sind es Leierschwänze?) auf Hochspannungsleitungen und singen. Es dauert ein wenig, bis man versteht, dass das Pfeifen der herannahenden Geschosse tatsächlich aus ihren Schnäbeln dringt. Die Vögel imitieren die Fluggeräusche der Raketen, sie singen das Herannahen der Gefahr. Nachdem ich deinen letzten Brief gelesen hatte, Ofer, schaute ich mir diese Aufnahme mehrmals an und fragte mich, welche Lieder du und ich singen würden, wenn nicht Krieg wäre. Wozu würden wir uns schreiben? Worüber nachdenken, worüber streiten. Wir würden über Thomas Brasch diskutieren und Zadie Smith zitieren. Du würdest versuchen, mich vom Weihnachtsoratorium zu überzeugen, ich würde dir die ersten Seiten meines neuen Romans vorlesen, mir auf die Lippen beißen und deine Kritik aushalten. Wir würden bedenkenlos in Neuköllner Bars einen trinken gehen (bedenkenlos, weil wir nicht aus Verzweiflung, sondern auf das Leben das Glas heben). Like a bird on the wire heißt es bei Leonard Cohen, und ich würde gerne mit dir den Song wechseln. Machen wir das? Lass uns das irgendwann machen. Es gibt so viele Songs, in denen ich noch nie gewesen bin.
Aber bis dahin –
Das Bild von der Shiva, bei der du saßt, begleitet mich. Zu einem, weil ich – das schrieb ich dir zu Anfang des Krieges – so gerne Shiva sitzen würde, aber mit wem? Und für wen genau? In Deutschland und Österreich, den Ländern, in denen ich mich bewege, fehlt es an den Selbstverständlichkeiten, von denen du erzählst. Wer ist in meinem Fall dasVolk, von dem dein Nachbar im Sitzkreis so unmissverständlich reden konnte?
Ich bin in einem Vielvölkerstaat aufgewachsen. Nichts war gut an der Sowjetunion, aber diese eine Selbstverständlichkeit vermisse ich: dein Nachbar konnte Tscherkesse oder Georgier oder Ukrainer sein. Er konnte Belorussisch oder Litauisch oder Griechisch als Muttersprache haben. Leider sterben die mit Jiddisch als Muttersprache aus, aber meine Urgroßeltern konnten es noch. Ich hörte die Sprache, wenn ich sie in ihrer Datscha an der Wolga besuchte. Ich verbinde damit: ein wandgroßes Regal voller bauchiger Gläser mit selbstgemachter Marmelade, eingelegten Gurken, Tomaten und Paprika hinter der großen Holztür in der Küche. Die Kohlbeete, die ich gießen sollte und versehentlich unter Wasser setzte. Die böse dreinschauenden handgeschnitzten Waldgeister im Garten, die mich als Kind magisch anzogen – sie machten mir Angst, aber ich empfand auch eine ungeheure Lust, sie zu berühren und dann wegzurennen. Jiddisch – das sind für mich die Sketche, die die Erwachsenen spielten, die Witze, die sie sich erzählten und die ich nicht verstand und wie sie dabei in die Hände klatschten. Der Stolz in ihren Gesichtern. Ich verbinde mit Jiddisch die Erzählungen von Czernowitz und Odessa. In meinem Kinderkopf waren das jüdische Städte, fast schon imaginäre Orte, wie aus einem Märchen, in einem Land weit weit weg … Lange vor unserer Zeit, da war … Ja, was? Heute weiß ich, wie meine Familie vor den Deutschen floh, wie sie die Stalinzeit überlebte, wie 1953 meine Urgroßeltern geschasst wurden. Und ich weiß bis heute, wie die Schmiererei auf der Fassade ihres Wohnhauses in den Neunzigern aussah: „Judensäue, verpisst euch nach Israel“. Die Farbe der Buchstaben war blau. Ich kann mich an das Gesicht meines Urgroßvaters erinnern, der – verdienter Wissenschaftler in der UdSSR – im Fernsehinterview stolz erklärte, dass er an den Internationalismus glaube. Und dass die Zukunft der Menschheit hell und glücklich sein werde.
Wer waren wir? Unter Paragraph 5 unserer Geburtsurkunde war die ethnische Zugehörigkeit unmissverständlich vermerkt: Jewrej. Dann kamen wir nach Deutschland, und nichts war mehr klar: Für die Deutsche waren wir dieRussen. In den Sprachkursen saßen meine Eltern neben anderen, die als Juden aus den neugegründeten postsowjetischen Nationalstaaten geflohen waren und plötzlich fette Kreuze um den Hals trugen. Sie bezeichneten meine Eltern als was? Genau: Jewrej. (Manchmal auch als – siehe die blaue Schmiererei auf der Hausfassade meiner Urgroßeltern.)
Bei uns saß nie jemand für jemand anderen Shiva. Meine Urgroßeltern hatten verfügt, nach ihrem Tod verbrannt zu werden. Auf der Grabplatte, die sie noch selbst ausgesucht hatten, ist kaum Platz für mitgebrachte Steinchen, weil ihre Namen und Berufsbezeichnungen beinahe den gesamten Raum einnehmen. Es war ihnen wichtig – stolz wie sie waren –, dass die Funktionen, die sie in der Gesellschaft hatten, dort vermerkt waren: Professor. Ärztin.
Beerdigt sind sie auf dem Friedhof einer Kleinstadt in Niedersachen (jener Kleinstadt, in der unser Asylheim stand), wo es, das kannst du dir denken, natürlich keinen jüdischen Friedhof gab und von wo ich abhaute, so schnell ich konnte. Ohne Schulabschluss und ohne einen Plan fürs Leben. Die Stadt war übrigens damals schon bekannt für Neonazi-Aufmärsche, und in regelmäßigen Abständen mussten die Hakenkreuze entfernt werden, die auf die Tür der Jüdischen Gemeinde gesprayt wurden. Ich wollte raus aus Deutschland, ging in die USA, hasste es, reiste nach Israel, kehrte zurück nach Deutschland und stritt mich furchtbar mit meinem Urgroßvater. Ich sagte irgendwelche schlimmen Dinge über Israel (ich erinnere mich nicht mehr an den Wortlaut). Und er, Alexander, Shura, Sasha, der, dessen Namen ich trage, der Internationalist, der Arzt der Roten Armee, sagte fassungslos: „Deutschland hat dich zu einer Antisemitin gemacht!“ Das war eine unserer letzten Auseinandersetzungen. Ich hatte nicht mehr die Gelegenheit, ihn zu befragen, was genau er damit meinte, ihm zuzuhören und mich besser zu erklären. Ich war aufgebracht, ich schmollte. Der Zwist blieb ungelöst. Ich saß für ihn nicht Shiva, ich erinnere mich kaum an sein Begräbnis, aber ich rede häufig mit ihm, bis heute, fast täglich. Immerhin ist er mein Schutzpatron. Er ist nach wie vor da. Gleichzeitig bin ich froh, dass er unsere Gegenwart nicht mehr erleben muss (die helle, glückliche Zukunft, von der im Fernsehen gesprochen hat). Reicht schon das letzte Jahrhundert.
Jetzt kommt eine Nachricht von dir, Ofer.
Am Anfang dieses Briefes habe ich mir von dir einen neuen Song gewünscht. Ich bin noch gar nicht vom Tisch aufgestanden, geschweige denn, dass ich diese Zeilen hier abgesendet hätte, da schickst du mir schon ein Lied von Hanoch Levin. (Ist der Telepathie-Kanal bei dir eigentlich immer offen?)
Du schickst Shachmat, das Friedenslied:
My boy once at my breast is now a cloud of snow.
A pawn that’s black is striking a white foe.
My father’s tender heart is now a frozen sack.
A pawn that’s white destroys a pawn that’s black.
Crying in the rooms and silence on the green,
The king is playing with the queen.
Und ich muss sofort an das Lied Shalom von Adrienne Cooper denken.
If my voice were louder,
If my body stronger,
I would tear through the streets,
Crying: Peace, Peace, Peace.
Volt ikh gehat koyekh,
Volt ikh gelofn in di gasn,
Volt ikh geshrign sholem,
Sholem, Sholem, Sholem.
Lu haya li koach,
Hayiti ratsa barechov,
Hayiti tsoeket shalom,
Shalom, Shalom, Shalom.
In meinem Kopf wächst eine ganze Playlist, eine Art Übersetzung unserer Zeit. Meiner Forderungen, meiner Wünsche. Ich kann unsere Gegenwart ohnehin am besten in Bildern denken. In Liedern, Ausrufen, Zitaten. In riesigen Projektionen auf der Fassade hier im Wiener Museumsquartier, wo ich wohne. Heute stand da doch tatsächlich: Wer sind wir?
Gestern: Peace.
Vorgestern: Wir worten zurück.
Ich glaube, mein Herz ist an diese Projektoren angeschlossen. Alles wird sichtbar. Metergroß. Menschen trinken ihren Weihnachtspunsch auf dem Platz davor und starren darauf. Kommentieren.
Morgen wird da stehen: Wish you were here.
Aktuelle Stories

Martina Hefter
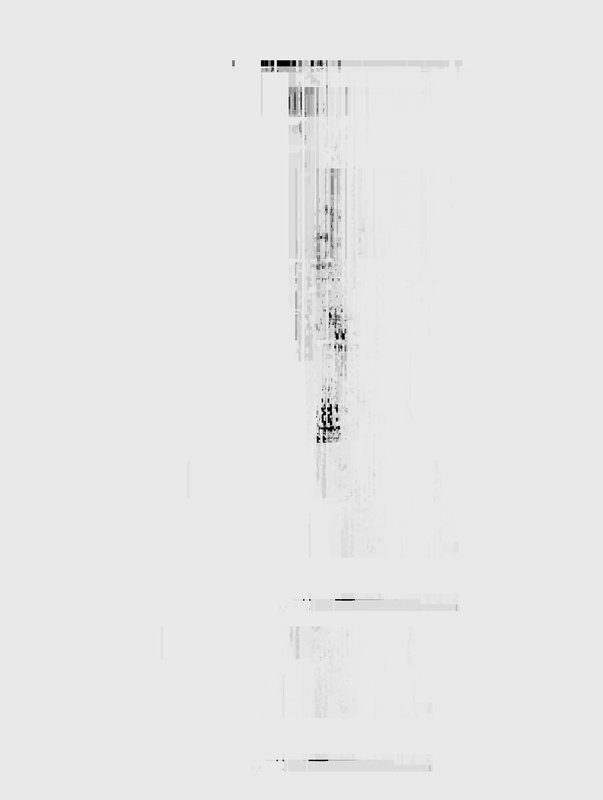
Interview mit Michał Matejko
„Ich bin davon überzeugt, dass alle großen Realitäten bereits vor uns liegen“

Katja Lange-Müllers Rede zum Jahresempfang 2025

Landtagswahl in Thüringen
 [1]
[1] [2]
[2]![[3] „Wir worten zurück“, Foto: © Sasha Salzmann](/media/filer_public_thumbnails/filer_public/cd/2b/cd2bc4df-c4bb-4972-abf7-eb10a861dccf/tmpcsm_bild_3_3ba0e9ade3.jpg__300x399_q85_exact_subject_location-210%2C280_subsampling-2.jpg)