
Ein Anfang. Begegnungen mit dem „weiblichen Weimar“
Wahrnehmungsbericht
In einem literarischen Spaziergang fragt Lis(a) Bußler, wie man sich dem „weiblichen Weimar“ annähern kann. Ein Beitrag zum Internationalen Frauentag
September 2020 verbringe ich viele Stunden am Tag damit, Weimar bei spätsommerlichen Spaziergängen zu erkunden. Ich bin erst kürzlich hierhergezogen. Da ich nur fünf Fußminuten von dem Park an der Ilm entfernt wohne, verschlägt es mich oft dorthin.
Ich mache einen meiner Erkundungsspaziergänge:
Wielandplatz
Frauenplan
Frauentorstraße
Marktplatz
Platz der Demokratie;
Zentral auf dem Platz der Demokratie, in unmittelbarer Nachbarschaft zum Park an der Ilm, entdecke ich eine Statue aus Stein, die auf einem Sockel steht: ein Reiter auf einem Pferd. Ich trete an die Statue heran, um die Inschrift zu lesen: „Carl August 1757 – 1828“. Mir ist so, als hätte ich schon öfter von dieser Person gehört, aber ich weiß nicht, wer das ist.
Ich gehe weiter und überquere die Straße:
Herzogin Anna Amalia Bibliothek
Burgplatz
Stadtschloss Weimar
Sternenbrücke
Park an der Ilm auf der einen Flussseite
Brücke nahe Goethe’s Gartenhaus
Park an der Ilm auf der anderen Flussseite
Beethovenplatz
Ackerwand
Wielandplatz.
Ich bin wieder zuhause. Hier gebe ich „Carl August“ in die Suchmaschine ein und lerne, dass der Reiter auf dem Platz der Demokratie ein deutscher Fürst war und mit seiner Volljährigkeit Herzog von Sachsen-Weimar-Eisenach wurde. 1815 trug er dann den Titel eines Großherzogs. Bis zu seiner Volljährigkeit stand er unter der Vormundschaft seiner Mutter Anna Amalia. Mit dem Wissen, dass die berühmte Herzogin Anna Amalia Bibliothek nur wenige Meter von Carl August’s Statue entfernt liegt, möchte ich mehr über sie erfahren und gebe ebenfalls ihren Namen in die Suchmaschine ein:
„Herzogin Anna Amalia wurde 1739 als Prinzessin von Braunschweig-Wolfenbüttel geboren und heiratete 1756 Herzog Ernst August II. Constantin von Sachsen-Weimar und Eisenach. Nach nur zwei Jahren Ehe verstarb Herzog Ernst August II. und Anna Amalia blieb bis zu ihrem Tod verwitwet. Da ihre Söhne Carl August und Friedrich Ferdinand Constantin noch zu jung […] waren, übernahm sie die Regentschaft, bis Carl August mündig war. Sie wirkte als Mäzenin und Komponistin, trug maßgeblich dazu bei, dass es Wieland und Goethe nach Weimar verschlug[,] und veranlasste den Umzug der Büchersammlung aus dem Residenzschloss in den Rokokosaal des ‚Grünen Schlosses‘. 1807 verstarb sie in Weimar.“
Interessant, dass ich zuerst Carl August recherchierte und erst dann Anna Amalia, obwohl sich Statue und Bibliothek in unmittelbarer Nähe zueinander befinden. Dieser präsente Reiter auf dem Platz ist mir zuerst ins Auge gestochen. Die gelbe Fassade der Bibliothek habe ich nur als Kulisse wahrgenommen. Ich erfuhr von einer Weimarer Frauenfigur primär über ihren Sohn.
*
Knapp zwei Jahre später beginnt im Januar 2023 für mich ein dreimonatiges Praktikum im Medienteam der Klassik Stiftung Weimar. Das Büro befindet sich im Stadtschloss, wohin ich mich ab dem 4. Januar auf den Weg mache:
Wielandplatz
Frauenplan
Vorbei an Goethe’s Wohnhaus
Frauentorstraße
Marktplatz
Grüner Markt
Burgplatz
Stadtschloss Weimar.
Mitte Januar 2023 ziehe ich innerhalb Weimars um und gehe nun einen anderen Weg ins Büro:
Ernst-Kohl-Straße
Rathenauplatz
Am Museum Neues Weimar vorbei
Weimarplatz
Harry-Graf-Kessler-Straße
Am Bauhaus-Museum Weimar vorbei
Friedensstraße
Rollgasse
Rollplatz
Karlstraße
Eisfeld
Herderplatz
Mostgasse
Schloßgasse
Burgplatz
Stadtschloss Weimar.
Am 16. Februar 2023 zieht der Stubengarten von Großherzogin Maria Pawlowna Romanowa anlässlich ihres Geburtstages in den Kubus des Studienzentrums der Herzogin Anna Amalia Bibliothek ein. Die Klassik Stiftung Weimar veröffentlicht eine Pressemitteilung. Es folgen weitere Beiträge zum Stubengarten auf den Social-Media-Kanälen. Es ist das erste Mal, dass ich von Maria Pawlowna und dieser Tradition höre. Ich bin neugierig:
„Maria Pawlowna Romanowa wurde 1786 in Pawlowsk bei Sankt Petersburg geboren und war Großfürstin von Russland. Durch ihre Heirat mit dem Erbprinzen Carl Friedrich von Sachsen-Weimar und Eisenach wurde sie Schwiegertochter von Herzog Carl August und Herzogin Luise. Weimar profitierte durch ihre liberale Haltung und Präsenz, die von großer politischer Bedeutung war. Sie nahm am Wiener Kongress teil, der für Sachsen-Weimar-Eisenach die Rangerhöhung zum Großherzogtum bedeutete. Nach dem Tod ihres Schwiegervaters 1828 bestieg sie mit ihrem Ehemann den Thron und war als Förderin der Künste am Weimarer Hof bekannt. 1859 verstarb Maria Pawlowna auf Schloss Belvedere bei Weimar.“
Zum Feministischen Kampftag startet die Klassik Stiftung Weimar am 8. März 2023 eine Beitragsreihe auf Social Media, die mit dem 14. März endet. Bei der Recherche für die Beiträge lerne ich – neben Herzogin Anna Amalia und Maria Pawlowna – weitere Frauenfiguren kennen:
Charlotte von Stein (1742-1827), geborene von Schardt, nahm „im klassischen Weimar die Rolle einer Mentorin für die ihr nachkommende Frauengeneration ein, darunter Charlotte von Schiller.“ Sie war eine Hofdame von Herzogin Anna Amalia, enge Vertraute von Herzogin Luise von Sachsen-Weimar-Eisenach sowie enge Freundin von Carl Ludwig von Knebel und die wichtigste Bezugsperson für Goethe.

Herzogin Luise von Sachsen-Weimar und Eisenach (1757-1830), geborene Prinzessin von Hessen-Darmstadt, Frau von Herzog Carl August von Sachsen-Weimar und Eisenach. „Als Napoleon nach den Schlachten von Jena und Auerst[e]dt mit seinen Truppen in Weimar einzieht, stand Luise ihm 1806 gegenüber, verteidigte ihren Mann und brachte Napoleon dazu, weitere Plünderung der Stadt zu unterlassen, was ihr größte Bewunderung und Respekt einbrachte.“ An dieser Stelle höre ich das erste Mal von der Doppelschlacht bei Jena und Auerstedt am 14. Oktober 1806.

Johanna Schopenhauer (1766-1838), geborene Trosiener, war Mutter von Arthur sowie Adele Schopenhauer und zog nach dem Freitod ihres Mannes 1805 nach Weimar. „Johanna unterstützte Weimar nach der Schlacht bei Jena und Auerstedt im Oktober 1806, was ihr einen guten Ruf einbrachte. Sie veranstaltete wöchentliche Teegesellschaften in ihrem Salon.“ An dieser Stelle höre ich das zweite Mal von der Doppelschlacht bei Jena und Auerstedt am 14. Oktober 1806.

Charlotte von Schiller (1766-1826), geborene von Lengefeld, „und ihre Schwester Caroline lernten Schiller 1787 kennen, der sich bei der Zuneigung der beiden für ihn und seiner Zuneigung für die beiden schließlich für Charlotte entschied. […] Charlotte […] beschäftigte sich mit Philosophie, Literatur und Naturwissenschaft, wobei sie auch unkonventionelle Anschauungen vertrat.“

Karoline Jagemann von Heygendorff (1777-1848), auch Caroline Jagemann genannt, „war Teil des ‚Weimarer Quartetts‘ und wurde 1801 Geliebte von Herzog Carl August, der sie zur ‚Freifrau von Heygendorff‘ ernannte und ihr das Rittergut Heygendorf überließ. […] 1817 übernahm Karoline die alleinige Leitung des Hoftheaters als Opern- und später Oberdirektorin.“

Adele Schopenhauer (1797-1849) „beschäftigte sich viel mit Literatur und schrieb auch selbst unter den Pseudonymen ‚Henriette Sommer‘ und ‚Adrian van der Venne‘. Mit Ottilie von Goethe verband sie eine enge Freundschaft. 1827 verließen Adele und ihre Mutter Weimar und zogen 1829 in die Nähe von Bonn. Dort freundete Adele sich mit Sibylle Schaafhausen an, mit der sie später eine Liebesbeziehung und Lebensgemeinschaft führte, bis sie 1849 in Bonn verstarb.“

Ottilie von Goethe (1796-1872), geborene Freiin von Pogwisch, „kam 1806 nach der Schlacht von Jena und Auerstedt mit ihrer Mutter und Schwester nach Weimar, wo sie eine enge Freundschaft mit Adele Schopenhauer führte. 1817 heiratete sie Goethes Sohn August und zog mit ihm in Goethes Wohnhaus. […] Ottilie gründete das mehrsprachige Journal Chaos und gab es heraus. Nach Augusts Tod 1830 lebte sie weiterhin bei Goethe, den sie [‚]Vater[‘] nannte und half ihm unter anderen bei der Ausarbeitung von ‚Faust II‘.“

Helene Börner (1867-1862) wurde als Tochter des großherzoglichen Hofmusikers Eduard Friedrich Edmund Börner in Weimar geboren. Ab 1903 war sie Geschäftsführerin von dem „Verein für weibliche Handarbeit“ und von 1905 bis 1920 von der Weimarer „Paulinenstiftung für gewerblichen Hausfleiß“. Sie unterrichtete an der Kunstgewerbeschule Weimar schwedische Weberei sowie Strickerei und leitete dort die Teppichknüpferei. 1920 wurde Helene Börner am Bauhaus als „Meisterin des Handwerks“ gekürt und war die handwerkliche Leiterin der Werkstatt für die Bauhaus-Weberei.
Benita Koch-Otte (1892-1976), geborene Otte, war Textildesignerin. 1920 immatrikulierte sie sich am Staatlichen Bauhaus in Weimar, wo sie zunächst Schülerin und später Mitarbeiterin in der Werkstatt für die Bauhaus-Weberei war. Sie fertigte 1923 den Kinderzimmer-Teppich für das Musterhaus Am Horn an und entwickelte mit Ernst Gebhardt – ebenfalls für die Bauhausausstellung – die dort vorfindbare Küche.
Katt Both (1905-1985) „war von 1925 bis 1928 Bauhäuslerin in Dessau und lernte in der Tischlerwerkstatt, die zu der Zeit von Marcel Breuer geleitet wurde. Vor ihrer Bauhaus-Zeit war sie an der Kunsthochschule in Kassel eingeschrieben, von wo aus sie an die Staatlich-städtische Kunstgewerbeschule Burg wechselte. Katt war Architektin und Möbeldesignerin.“
Der Großteil dieser Frauen war als Schwieger-/Tochter, Frau, Geliebte oder Mutter von einem Mann bekannt. Sie standen und stehen – auch heute noch – selten nur für sich. Herzogin Anna Amalia lernte ich als Mutter von Herzog Carl August kennen; Großherzogin Maria Pawlowna als Frau von Herzog Carl Friedrich sowie Schwiegertochter von Herzog Carl August und Herzogin Luise. Außerdem fällt mir während der Recherche auf, dass die meisten Männer (nach der ersten vollständigen Namensnennung) innerhalb eines Textes nur bei ihren Nachnamen genannt werden, wie zum Beispiel „Goethe“. Frauen werden dahingegen nach der ersten vollständigen Namensnennung bei ihren Vornamen genannt, wie zum Beispiel „Ottilie“. Das macht eine soziale Hierarchie innerhalb einer Familie kenntlich sowie die Abhängigkeit der Frau vom „Familienvater“.
Im Lauf meiner Zeit bei der Stiftung besuche ich die historischen Orte und Museen, die ich bisher noch nicht von innen gesehen habe: das Wittumspalais, das Museum Neues Weimar, Goethe’s Wohnhaus und das dazugehörige Nationalmuseum, Schiller’s Wohnhaus sowie das daran anschließende Museum. Hier begegne ich manchen Frauen wieder: Herzogin Anna Amalia, Charlotte von Stein, Christiane von Goethe, Ottilie von Goethe, Charlotte von Schiller.
In den letzten Jahren habe ich mich immer wieder mit Persönlichkeiten aus Weimar beschäftigt, allerdings lag mein Fokus bis zu meiner Zeit bei der Stiftung nicht auf Frauen. Im Oktober 2020 ging ich beispielsweise in das Bauhaus-Museum Weimar. Ich erinnere mich daran, wie ich interessiert die Namen an den Exponaten las. Dazu zählten neben den bekannten Namen, wie Walter Gropius, Paul Klee oder Wassilly Kandinsky, auch andere Namen. Unter anderem Namen von Frauen, aber neben einem Plural an Männernamen steht oft nur ein Frauenname. Ich kann mich nicht an diese Frauennamen erinnern. Damals, in meinem Kunstunterricht, als es um das Bauhaus ging, hatte ich nichts von ihnen gehört; von den Männern dahingegen schon. Es wird deutlich weniger von Frauen gesprochen. Das macht es leicht, sie zu vergessen. Ich möchte das „weibliche Weimar“ weniger vergessen und mehr entdecken. Ich möchte genauer hinsehen und Fragen stellen.
Mit dem 31. März 2023 endet meine Zeit bei der Klassik Stiftung Weimar. Mit einem sensibilisierten Blick für die Weimarer Geschichte und seine Figuren mache ich mich ein letztes Mal vom Büro auf den Weg nach Hause:
Stadtschloss Weimar
Hier wohnten unter anderem Herzogin Anna Amalia, Charlotte von Stein, Herzogin Luise und Großherzogin Maria Pawlowna / Die ersten vier Frauen, denen ich begegne
Burgplatz
Schloßgasse
Mostgasse
Am „Jagemanns Restaurant“ vorbei / Nach Caroline Jagemann benannt und damit die fünfte Frau, der ich begegne
Herderplatz / Nach Johann Gottfried Herder benannt und damit der erste Mann, dem ich begegne
Eisfeld
Karlstraße
Rollplatz
Rollgasse
Friedensstraße
Am Bauhaus-Museum vorbei / Welchen Frauen begegne ich hier (wieder)?
Harry-Graf-Kessler-Straße / Der zweite Mann, dem ich begegne
Weimarplatz
Am Museum Neues Weimar vorbei / Welchen Frauen begegne ich hier (wieder)?
Rathenauplatz / Nach Walther Rathenau benannt und damit der dritte Mann, dem ich begegne
Ernst-Kohl-Straße / Der vierte Mann, dem ich begegne.
Mit dem Auftauchen der ersten Schneeglöckchen schlendere ich durch die Weimarer Innenstadt und über den Campus der Bauhaus-Universität Weimar:
Am Walter-Gropius- und Van-de-Velde-Bau vorbei / Die ersten zwei Männer, denen ich begegne
Hier waren die Werkstätten, in denen Helene Börner gelehrt hat und Benita Otte-Koch, Marta Erps-Breuer sowie Katt Both gelernt haben / Die ersten vier Frauen, denen ich begegne;
Ich laufe weiter in Richtung Stadtzentrum:
Marienstraße / Nach Maria Pawlowna benannt und damit die fünfte Frau, der ich begegne
Wielandplatz / Nach Christoph Martin Wieland benannt und damit der dritte Mann, dem ich begegne
Frauenplan / Nach der Marien- beziehungsweise Frauenkirche benannt, die an diesem Platz und unter dem Patrozinium der heiligen Maria stand, und damit die sechste Frau, der ich begegne
An Goethe’s Wohnhaus vorbei / Der vierte Mann, dem ich begegne
Hier wohnte unter anderem Ottilie von Goethe / Die siebte Frau, der ich begegne
Frauentorstraße / Warum beinhaltet die Bezeichnung einer Kirche und eines Tors den personenunspezifischen Begriff „Frauen“?
Schillerstraße / Nach Friedrich Schiller benannt und damit der fünfte Mann, dem ich begegne;
Vor der Hausnummer Zehn bleibe ich stehen
Mein Blick wandert nach links
An Schiller’s Wohnhaus vorbei
Dort wohnte unter anderem Charlotte von Schiller / Die achte Frau, der ich begegne
Mein Blick wandert weiter nach oben
Auf die Steintafel der Hauswand vor mir:
„Hier stand das Haus, in dem die Schriftstellerin Johanna Schopenhauer (1766 – 1838) ihren Salon von 1806 bis 1813 führte.“ / Die neunte Frau, der ich begegne;
Von dieser Tafel und ihrem Inhalt weiß ich nur aufgrund meiner Recherche zu Johanna Schopenhauer und ihrer Rolle als Salonnière, die sie unter anderem während der Doppelschlacht bei Jena und Auerstedt einnahm. Davor ist mir die Tafel nie aufgefallen, obwohl ich regelmäßig durch die Schillerstraße gehe.
Ich setze meinen Weg fort:
Frauentorstraße
Marktplatz
Studienzentrum der Herzogin Anna Amalia Bibliothek / Die zehnte Frau, der ich begegne.
Ich stehe also wieder vor der Herzogin Anna Amalia Bibliothek. Dieses Mal vor dem neuen Gebäude, dem Studienzentrum. Ich möchte das „weibliche Weimar“ weniger vergessen und mehr entdecken. Ich möchte genauer hinsehen und Fragen stellen. Hier knüpfe ich an meine bisherigen Recherchen an und merke schnell: Die Literaturliste ist endlos.
Auszug aus der Literaturliste
Die starken Frauen am Weimarer Hof (2021) von Caroline Deich
Chaos. Ottilie von Goethes Journalpoetik (2022) von Astrid Dröse
Blaupause (2019) von Theresia Enzensberger
Auf den Spuren der Familie Schopenhauer. Einblicke in die Sammlungen der Herzogin Anna Amalia Bibliothek (2021) von Francesca Fabbri
Mit einem wilden angeborenen Freiheits-, ja Rebellensinn (2022) von Francesca Fabbri über Ottilie von Goethe
Die Schwiegertochter. Das Leben der Ottilie von Goethe (2021) von Dagmar von Gersdorff
Weibliche Mythen in Musik, Literatur und bildender Kunst (2015) von Hellen Geyer und Maria Stolarzewicz im Rahmen der öffentliche Ringvorlesung Frauengestalten – Mythos: seismographische Exepmla
1919. Das Jahr der Frauen (2018) von Unda Hörner
Ottilie von Goethe und die englischsprachige Welt (2022) von Waltraud Maierhofer
Natalie von Milde – Weimars vergessene Feministin (2022) von Jonah Martensen
Frauenpersönlichkeiten der Weimarer Klassik (1999), Frauenpersönlichkeiten in Weimar zwischen Nachklassik und Aufbruch in die Moderne (1999) und Die klugen Frauen von Weimar. Regentinnen, Salondamen, Schriftstellerinnen und Künstlerinnen (2013) von Ulrike Müller
Mathilde von Freytag-Loringhoven. 1860-1941, Malerin – Tierpsychologin – Kritikerin des Bauhauses (2019) von Antje Neumann-Golle, Jens Riederer und Uta Junglas
Johanna Schopenhauers Salon in Weimar. Die Kultivierung des Komischen und die zwiespältige Rezeption der Romantik (2022) von Günter Oesterle
Anna Amalia von Weimar. Regentin, Künstlerin und Freundin Goethes (2019) von Carolin Philipps
Charlotte von Stein. Schriftstellerin, Freundin und Mentorin (2018) von Richter Elke und Alexander Rosenbaum
Das Lesezimmer des „Vereins Frauenbildung-Frauenstudium“ (2019) von Jens Riederer
Der Umgang hier scheint mir sehr angenehm. Briefe, Reisepassagen und Kunstbetrachtungen von Johanna Schopenhauer und 2016 herausgegeben von Ulrike Müller
Gretha Jünger. Die Unsichtbare Frau (2020) von Ingeborg Villinger
...
Weitere Beiträge

Martina Hefter
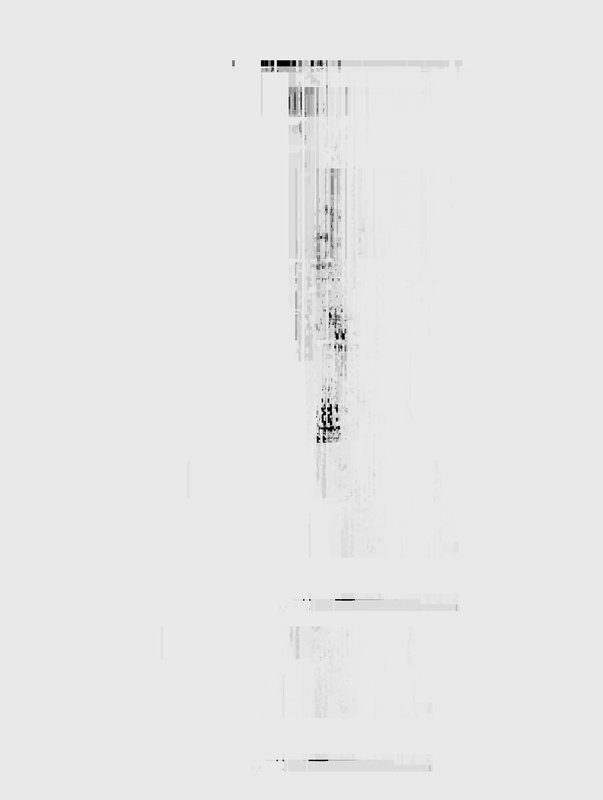
Interview mit Michał Matejko
„Ich bin davon überzeugt, dass alle großen Realitäten bereits vor uns liegen“

Katja Lange-Müllers Rede zum Jahresempfang 2025

Landtagswahl in Thüringen




