
Schriftstellerin Katja Lange-Müller, © IMAGO / Funke Foto Services (Foto: Mauriziox Gambarini)
Die Sinne, die Kunst und die Onlinewelt
Katja Lange-Müllers Rede zum Jahresempfang 2025
*** Es gilt das gesprochene Wort ***
Guten Abend!
Bitte lassen Sie mich, auch wenn dies aus dem gegebenen feierlichen Anlass womöglich zum ersten Mal geschieht, mit einem Witz beginnen: Der kleine Paul kommt nachhause und sagt zu seiner Mutter: „Mama, ich will nicht mehr zu Oma und Opa!“ – „Aber wieso denn nicht“, fragt die Mutter, „du warst doch immer gerne dort.“ Darauf Paul: „Nee, das ist so ätzend. Die sitzen den ganzen Tag auf dem Sofa und haben nichts an.“ Die Mutter schlägt bestürzt die Hände vors Gesicht. „Wie? Die haben nichts an?“ – „Na ja“, antwortet Paul, „keine PlayStation, kein iPhone, kein Laptop, kein TV, nicht mal ein Radio.“
Damit Sie mich richtig verstehen, ich werde selbst in einem Monat 74, bin also im besten Oma-Alter, trotzdem sitze ich viel zu selten auf dem Sofa und habe nichts an. – Warum dann dieser Witz? Weil er Oma und Opa quasi als passive Widerstandskämpfer darstellt und den entscheidenden Unterschied zwischen deren Generation und der all der heranwachsenden Pauls und Paulas so treffend zuspitzt. Nicht nur diversen Untersuchungen zufolge sind die lieben Kleinen ja ganz vernarrt in Mobiltelefone und sonstige elektronische Medien, und das zu fast jeder Tages- und sogar Nachtzeit, wie aus einschlägigen Studien über den Umgang der Sieben- bis Vierzehnjährigen mit TikTok, Instagram, Snapchat und Co. hervorgeht.
Gewiss, das Thema Online-Welt versus Offline-Welt ist riesig, denn wir leben im Zeitalter der „Digitalmoderne“; längst werden im Internet Themen behandelt und manipuliert, die über unsere gesellschaftliche, politische, ja sogar die persönliche Gegenwart und die nahe Zukunft mitentscheiden: Wahlergebnisse, kriegerische Konflikte und die Berichterstattung darüber, Terrorakte, Parteipropaganda, der Umgang mit Geflüchteten, das Bildungsdilemma, der psychische Zustand der Jugendlichen und besonders der Kinder, die nicht mehr zusammen auf den Straßen spielen, sondern gegeneinander, jedes an seinem PC, Tablet oder Handy.
Die Folgen der Digitalisierung, die zunächst als große Kommunikationserleichterung auf den Gebieten Wissenschaft, Industrie und Handel gefeiert wurde, sind ebenso bekannt, benannt, beschrieben wie die Digitalisierung selbst, die schon heute tief in sämtliche Lebensbereiche der Menschen eindringt und uns das Dasein eben nicht mehr nur erleichtert; nein, so peu à peu erfasst sie uns gänzlich, mit Haut und Haar oder von Kopf bis Fuß. Wörter wie Internetkriminalität, Darknet, Cyberwar, Cybermobbing und Cyberstalking sind in aller Munde – und betreffen natürlich nie uns selbst, denn wir, aufgewachsen in der Zeit davor, haben uns und unsere technischen Hilfsmittel ja im Griff.
Daran will auch ich gerne glauben und nicht den Teufel an die Wand malen; ebenso wenig sollen Sie mich für eine Maschinenstürmerin halten. Es ist nun mal, wie es ist: Unsre Spezies, die sich in christlichen Kreisen nach wie vor als „die Krone der Schöpfung“ versteht, entdeckt und erfindet von jeher was immer sich entdecken und erfinden lässt. Unsere evolutionäre Entwicklung, die manche Humanbiologen längst für abgeschlossen hielten, setzte und setzt sich fort in diversen technischen Revolutionen, deren radikalste sicher die jetzige ist. Wo stehen wir gerade? Etwa bereits dort, wo der Weg der Menschheit sich gabelt und der rechte oder linke Abzweig zum Scheideweg wird? Sind wir die Schwestern und Brüder des berühmten „Zauberlehrlings“ aus Goethes Feder und werden die Geister, die wir riefen, „nun nicht los“? Beginnen, mit KI am Motherboard, die von uns erfundenen Geräte nun womöglich ihrerseits uns zu manipulieren? Machen Algorithmen mit humanoiden Fähigkeiten uns am Ende zu einem Geschlecht von organogenen Robotern? – Apropos Geschlecht, in einem Podcast des Deutschlandfunks, der sich diesem Thema widmete, erfuhr ich, dass sich schon 20 Prozent aller Menschen, die KI intensiv nutzen, dafür interessieren, wie man mit einem Bot sexuell interagieren könnte. Daraufhin recherchierte ich weiter, und ja, solche Angebote gibt es. KI verändert auch die Erotik-Branche rasant. Eine wachsende Zahl von Menschen nutzt Chatbots und KI-Avatare für intime Konversation. Sex-Toys, Sexpuppen und -roboter lernen dank KI immer besser, die speziellen Vorlieben ihrer Nutzerinnen und Nutzer zu bedienen. Man kann sich den Partner, den man sich wünscht, inzwischen tatsächlich „backen“, Augen-, Haar- oder Hautfarbe, Brustgröße, Stimme, Wesensart, devot oder ein wenig frech, alles wählbar. Der Bot ist eine teure Freundin, ein treuer Freund – und bereit, auf diejenigen, die ihn gekauft haben oder abbezahlen, jederzeit einzugehen. Und logischerweise nennt die Porno-Industrie diese, ich zitiere, „neuen Möglichkeiten, der Einsamkeit zu entrinnen“ eine „große Hilfe für physisch oder psychisch beeinträchtigte und kontaktscheue Zeitgenossen“. Ein Anbieter rühmt seine „unermüdliche Arbeit an ‚sexpositv-quer-feministischen‘ Sprachmodellen“ für jene Avatare, die er „performt“, gar als „die einzig wahrhafte sexuelle Befreiung“. Und voriges Jahr hat die Autorin Martina Hefter den Deutschen Buchpreis gewonnen – mit einem das Sujet behandelnden Roman, in dem Juno, eine Autorin und ehemalige Tänzerin, die tagsüber ihren an MS erkrankten Ehemann und Kollegen Jupiter pflegt, des nachts auf Dating-Seiten diverse Love-Scammer trifft, bis sie einen von ihnen, einen eloquenten Nicaraguaner, listig lügend entlarvt.
Wie Sie merken, verehrtes Publikum, habe ich nun doch ein paar Teufel an die Wand gemalt. Teufel oder Engel? Die einen sehen es so, die anderen so. – Unbestreitbar ist, dass die Online-Welt täglich größer wird, während die Offline-Welt zu schrumpfen scheint. „Das Internet“, schreibt Eva Menasse in ihrem klugen Essay Zeitenwende, „mag als Werkzeug gedacht gewesen und es in Teilen noch immer sein. Aber eine Fähigkeit, an der vorab niemand einen Nachteil hätte erkennen mögen, richtet unter den Menschen enorme Verheerungen an: die digitale Massenkommunikation. Nichts hat unser Leben und Verhalten innerhalb weniger Jahre derart gravierend verändert. Als wäre es eine Weltformel, können die Dauervernetztheit der Menschen, ihr Dauergespräch, ihr Dauerstreit zur Erklärung von vielem, fast allem, herangezogen werden, was seither so unerklärlich angeschwollen ist, die Wut, der Hass, die Überforderung, der Frust, der grassierende Irrationalismus, die Verschwörungserzählungen, die politische Extremisierung …“ – Ja, genau, das Digitale in seinen vielfältigen, tatsächlich netzartigen Erscheinungsformen brach mit der Wucht eines Urknalls über die Menschheit herein und schneller als jede frühere Erfindung; und wohin uns all die Apps, die sozialen oder asozialen Medien, die Accounts und Foren noch führen, speziell seit auch die künstliche Intelligenz hinzukam und sich auf ausnahmslos jedem Gebiet weiterentwickelt, das vermag kaum jemand vorherzusagen. Beim Zeitunglesen, am Radio, an den TV-Geräten, den Festnetztelefonen, eben den guten alten Massenmedien, waren und sind wir überwiegend Konsumenten, Empfänger. Doch seit es Mobilfunk gibt, haben diese neuen Telefone, die, obwohl sie ja Computer sind, seltsamerweise noch immer das Wort Telefon im Namen führen, uns zu Sendern erhoben, liegt ein Teil der Medienmacht bei uns allen. Die Menschen scheiben nicht mehr einfach bloß Leserbriefe und E-Mails, sie twittern, chatten, posten, liken, was das Zeug hält, schließen sich Communitys oder Gruppen an und zu „Blasen“ zusammen, werden Influencer, präsentieren ihre Meinungen und Darbietungen, eben das, als was sie wahrgenommen, bewundert und mit möglichst vielen Followern belohnt werden wollen – auf YouTube- und sonstigen Kanälen. Das gilt als demokratisch, vermutlich zurecht, denn die Digitalisierung und selbst KI haben ja durchaus ihre Stärken.
Aber es gibt ein Problem. Der Planet Erde, den wir elektronisch umsurfen, als existierten – außer sprachlichen – zwischen den Kontinenten, den Ländern und deren Bewohnern keinerlei Entfernungen mehr, die Welt, auf der wir einander digital näher sind als unseren Nächsten physisch, gerade die ist eben nicht digital, sondern, wie der Technologie-Philosoph James Bridle sagte, „analog“, also real – oder wirklich, genau wie wir Homo Sapiens, wie all die Tiere und Pflanzen in unseren Häusern und davor, wie das Vogelgezwitscher, die grünenden Wälder, die rauschenden Meere, die traute Heimat, wie die Tsunamis, die Müllhalden, die Erderwärmung, die Kriege, derentwegen echte Artgenossen sterben. Artgenossen und Art-Genossen. – Das Wort Art-Genossen, katapultiert mich, eine Schriftstellerin, eine Künstlerin also, zum nächsten Glühpunkt. Ich und sicher auch Sie kennen ja durchaus noch einige Renegaten, die sich der globalen Digitalisierung teilweise oder gänzlich verweigern, die keine eigene Web-Seite und keinen Facebook- oder Twitter-Account haben, die sich nicht selbst zu Avataren machen, Avataren, die nur noch mit anderen halbmenschlichen oder komplett künstlichen Avataren verkehren, pseudosozial oder auch schon pseudoerotisch. – Vielleicht, sagt eine schwache Stimme der Hoffnung in mir, würde die Bedeutung dieser gut dotierten digitalen Selbst- und Produktevermarkter, die sich wie die Fliegen vermehren, ja doch verflachen, wenn wir alle, wenn jede und jeder von uns Podcaster oder wenigstens Influencer würde. Womöglich könnte ein solches Überangebot manche Menschen, sogar jüngere, derart langweilen, anöden, sättigen, dass sie die originäre Realwelt – oder zumindest das, was daran schön ist, wieder zu schätzen begännen. Darauf sollten wir aber nicht vertrauen. Denn selbst wenn wir uns hinreißen ließen, all unsere freie Zeit zu opfern – und unsere Liebe zum Wirklichen, zum original Originellen, zum atmosphärischen Reiz der naturgegebenen, künstlerischen und architektonischen Objekte, wie etwa der Weimarer Herzogin Anna Amalia Bibliothek, einer nicht allein berufsbedingten Liebe, die ich unter uns hier Anwesenden einfach mal voraussetze, was würde das nützen? Die Sinne, speziell drei dieser Sinne, die für die Wahrnehmung des Wirklichen gebraucht werden, Tastsinn, Geruchssinn, und Geschmackssinn, sind bei vielen Mitmenschen infolge ihres permanenten Aufenthalts in den Sphären der Online-Welt bereits schwer geschädigt oder kaum mehr vorhanden, denen genügen zwei Sinne, der visuelle und der auditive.
Um unsere fünf Sinne, die wir beisammenhaben müssen, von denen kein einziger abstumpfen darf, geht es mir. Was sollten wir, Künstler, Kulturschaffende, Kuratorinnen und Kuratoren, Lehrerinnen und Lehrer tun, damit die Offline-Welt in Konkurrenz zur Online-Welt ihr Gleichgewicht wiederfinden oder erstmal bloß halten kann? Die noch offline Aufgewachsenen unter uns benutzen die neuen Medien nur in Maßen, nur so weit ihre professionellen und persönlichen Bedürfnisse es erfordern. Anders, ganz anders sieht das bei vielen der jüngeren Menschen aus. Die stehen, zum Beispiel im Urlaub, und damit meine ich jetzt nicht die Blätter fossiler Bäume, vor einem Strauch, aus dem an einem langen Faden eine große grellgelbe Spinne hängt. Sie werden diese Spinne nicht bestaunen, nicht neugierig deren Netz berühren, sondern ihre iPhones zücken, um sie zu fotografieren oder zu filmen, denn was sie nicht in der Galerie ihrer Endgeräte haben, das existiert quasi nicht – beziehungsweise nur so. Und dann, zuhause, wird das Foto oder dessen Beschreibung an ChatGPT geschickt und nachgefragt, welches Monster einem da begegnet ist. Muss man sich etwa noch die Mühe machen, die eben erwähnte Herzogin Anna Amalia Bibliothek, Schillers Wohnhaus, das Goethe-Nationalmuseum oder sonst eine Stätte der Klassik Stiftung Weimar leibhaftig zu besuchen? Auf YouTube gibt es doch genug mit feierlichen Klängen unterlegte virtuelle Rundgänge – und nirgends den Hinweis, dass man sie, wäre man der Atmosphäre dieses oder jenes wundervollen UNESCO-Welterbes mit all seinen Sinnen ausgesetzt, entschieden mehr davon hätte. Kurz, das direkte sinnliche Erleben, wovon auch immer, ist für viele passé. Trotzdem reisen bislang noch viele Menschen hierher, um diese Schauplätze wirklich zu erleben. – Bislang ja, doch kann das so bleiben – ohne unser Zutun, ohne unseren Einsatz, nicht nur für den Erhalt unserer Kulturstätten in Weimar und anderswo?
Das Internet wird sich gewiss nicht von sich aus bescheiden oder gar in Frage stellen, erst recht nicht die KI; darum ist es höchste Zeit, den Menschen klarzumachen, worauf sie verzichten, wenn sie Abbildungen und Filmen mehr trauen als ihren eigenen analogen Augen, der im Welt-Weit-Web gespeicherten Musik mehr als einem wirklichen Konzert in einer Philharmonie oder auf einer Freilichtbühne, dem Herumgehüpfe irgendwelcher Girls in Panda-Kostümen mehr als ihrer Lust, selbst das Tanzbein zu schwingen, einer von KI auf Themenzuruf verfertigten Erzählung mehr als der einer oder eines schon toten oder noch lebenden Schriftstellers oder einer Schriftstellerin, dem Anblick eines originalen Rembrandt-Werks weniger als der gegoogelten Reproduktion. – Und neuerdings tritt KI auch schon auf dem Gebiet der Malerei gegen den Menschen an und beweist dabei erstaunliches kommerzielles Geschick. Ai-Da, ein Roboter mit blauen Augen, Pagenkopffrisur und Maschinenarmen, der 2019 an der Oxford University entwickelt wurde, schuf jenes Porträt des britischen Wissenschaftlers Alan Turing, das 2023 bei Sotheby’s für umgerechnet eine Million Euro versteigert wurde.
Sie finden mein Geschrei übertrieben? Dann beäugen Sie im Netz, wo sonst?, doch mal die Zahlen. Von einigen Attraktionen und spektakulär beworbenen Ausnahmen abgesehen gibt es von Jahr zu Jahr weniger Buchverkäufe, weniger Bibliotheks-, Theater-, Museums-, und Ausstellungsbesucher. – Die Begriffe Kunst und Künstlich werden kaum noch auseinandergehalten, obwohl sie sich antagonistisch gegenüberstehen und niemals tangieren, schon gar nicht künstlerisch. Ob das Wort Kunst von Können herrührt, ist fraglich, aber die Nachahmung, das Plagiat oder die Fälschung sind damit sicher nicht gemeint, wiewohl zumindest die Fälschung einiges Können voraussetzt. Kunst ist grundsätzlich original, wenngleich nicht immer originell, künstlich hingegen bestenfalls die Reproduktion, der mehr oder minder profane Ersatz. Ein künstliches Gebiss hat wenig gemein mit dem, was mal die eigenen Zähne waren. Künstliche Gelenke, egal wie akzeptabel sie funktionieren für den, der ihrer bedarf, sind Prothesen. Und welcher Unterschied könnte größer sein als der zwischen künstlicher Intelligenz und künstlerischer Intelligenz?! Gemälde, Gebäude, Ballett- oder Theaterinszenierungen, musikalische Kompositionen, Dichtung und Prosa sind beseeltes originäres Menschenwerk, also Kunst, eben wegen ihrer Einzigartigkeit. Aber das sehen die Softwareentwickler und unter ihnen die Frankensteins von heute und morgen, die im Interesse ihrer Unsterblichkeit bereits Avatare von sich selbst erschaffen, völlig anders. Die sind sicher, dass der schöpferische Genius, den sich bisher allein unsere Spezies zugutehält, auf lernfähige Algorithmen übertragbar ist; natürlich erst, nachdem sie mit allen möglichen menschlichen Werken gefüttert, nein, gemästet wurden; das ist letztendlich nur eine Frage der Rechnerkapazität, die unaufhörlich steigt und steigt. International bekannte Musiker von ABBA bis Robert Smith wehren sich via Petition gerade heftig dagegen, dass ihr kreatives Eigentum KI-generierten Programmen eingespeist und zu Klangarrangements genutzt wird, zu Tonfolgen, die ein unbedarfter Musikverbraucher kaum von echten, individuellen Kompositionen zu unterscheiden vermag. Das macht nicht nur Musikern Angst, auch das Berliner Netzwerk Autorenrechte sandte der Regierung der Bundesrepublik einen offenen Brief, den etwa 4.800 schreibende und übersetzende Mitglieder unterzeichnet haben. Darin wird gefordert, „die neue Haltung Deutschlands zur geplanten KI-Grundverordnung zu überdenken, da diese den „zuvor erreichten Konsens der EU-Staaten zur rechtlichen Regulierung von KI und insbesondere der Auskunftspflichten und der Risikoverantwortung für Entwickler generativer Informatik massiv unterläuft. Die Regierung der BRD will“, laut diesem Schreiben, „ebenso wie die Regierungen Frankreichs und Italiens, keine gesetzlich verpflichtende Regulierung mehr, sondern drängt seit November 2023 auf obligatorische Selbstregulierung. Sanktionen gegen Sicherheitsverletzungen, wie etwa Urheberrechts- und Datenschutzverletzungen, mangelnde Kennzeichnung und ethische Standards sind in solch einer verstörend kultur- und bürgerfeindlichen Haltung (…) nicht mehr vorgesehen“.
Das ist ein alarmierendes Signal, zumal die generative Informatik ja schon heute etliche Arbeitsplätze und Erwerbsmöglichkeiten der Kunst- und Kulturschaffenden bedroht, und weil sich durch KI-Produkte, die massenhaft auf den Markt drängen, die Zunahme von Desinformationen etabliert. Denn nachweislich bestehen die Grundlagen für generative KI aus nicht legal erworbenen Werken, deren Urheber dieser Nutzung weder zugestimmt haben noch darüber informiert oder gar dafür entlohnt wurden. Je mehr dieser technologischen Produkte den Markt ohne gesetzliche Regulation erobern, umso irreparabler wird der gesamtgesellschaftliche Vertrauensverlust in Texte, Bilder, Klänge und Informationen. Die entscheidende Frage, die auch unser Brief stellte, ist doch: „Regulieren wir Maschinen, die sich bei Menschen bedienen, um Menschen zu ersetzen, oder wählen wir die antihumane Ideologie des Geldes?“
Es ist höchste Zeit, der Entwicklung Künstlicher Intelligenz ein rechtskonformes Korsett zu verpassen, aber wir müssen ihr auch künstlerische und pädagogische Intelligenz entgegensetzen. Das ist in unser aller Interesse notwendig – und kann gelingen durch die, ich nenne es mal Erziehung der Sinne, besonders der Sinne unserer Kinder und Enkelkinder, die sich, wenn wir der Herausbildung ihrer fünf Sinne keine Beachtung schenken, mehr oder weniger freiwillig den leicht zugänglichen Verlockungen der Online-Welt hingeben. Ob das Corona-Virus und dessen weltweite Folgen, die den Triumph der digitalen Medien über alle anderen zweifelsfrei katalysiert haben, seinen Ursprung in einem chinesischen Labor nahm oder von einem Tiermarkt stammte, ist noch immer nicht restlos geklärt. Doch dass TikTok von dem chinesischen Unternehmen Byte Dance betrieben wird, wissen wir – und ebenso, dass es in der Volksrepublik China nur in einer zensierten Version läuft und für Kinder unter vierzehn Jahren mit der zeitlichen Begrenzung von lediglich vierzig Minuten pro Tag. Ist TikTok, bei Licht betrachtet, etwa in erster Linie eine ideologische Waffe im Kampf gegen unsere demokratischen Gesellschaftssysteme? Ich – und nicht nur ich – meine: Ja. Und dass gerade Elon Musk, dem bereits Twitter gehört, nun auch die Rechte an TikTok kaufen möchte, zumindest für die USA, beweist: er und Donald Tump wollen die manipulativen Möglichkeiten solcher Formate nun für ihre Zwecke nutzen.
Aber zurück zu unserem Denkvermögen, unserem Nervensystem, unseren Sinnen. Durch die neuen Medien und die Smartphones erhöhen sich Reizdichte und Reizfrequenz stetig, das überstrapaziert unser Gehirn und unsere Sinnesorgane gleichermaßen. Eine südkoreanische Studie konnte beweisen, dass der Anteil der unterschiedlichsten Neurotransmitter bei stark internetaffinen Probanden in steigenden Mengenverhältnissen nachweisbar ist. Dies wiederum hat ähnliche Auswirkungen wie Drogen- oder Spielsucht, weil beim Umgang mit sozialen Netzwerken schnell und viel Dopamin ausgeschüttet wird. Bekommt der Mensch eine Nachricht oder ein Match angeboten, empfindet er Freude und will dieses Glücksgefühl dann immer häufiger erleben. Das entfremdet ihn, ohne dass es ihm bewusst würde, sich selbst; er glaubt, er erhalte Aufmerksamkeit, habe Freunde, nehme teil an dem, was andere tun, wenngleich auch nur, um es zu posten. Die Jugendlichen sehen hübsche Gesichter und erfahren, wie man sich schönheitschirurgisch „optimiert“, wenn man sich von der Natur im Stich gelassen wähnt. Und dann stehen sie vorm Spiegel, unglücklich über ihre breite Nase oder ihre dünnen Lippen – und ihr leeres Portemonnaie. Sie hören sich schräge Gesänge an, bewerten diese und fühlen sich auf die Art beteiligt, doch kaum mal animiert, selbst zu singen. Ihre Augen und Ohren sind die einzigen von solchen Filmchen geforderten Sinnesorgane. Sie können die bewunderte und beneidete Influencerin nicht berühren, nicht riechen, nicht beurteilen, wie ihr Kuss schmeckt. – Aber keine Sorge, der „Campus der Sinne“ des Fraunhofer-Instituts Erlangen arbeitet schon daran, dass multisensorische Systeme bald in der Lage sein werden, alle menschlichen Sinneswahrnehmungen nachzubilden. Die dort Tätigen erforschen eifrig, wie unser Sehen, unser Hören, unser sensorischer Sinn, doch auch die chemischen Sinne Riechen und Schmecken, digital erfasst werden können. Selbstverständlich nur, um – Zitat: „beispielsweise Menschen mit Wahrnehmungsbeeinträchtigungen im Alltag zu unterstützen“.
Was nun können wir tun, bis es so weit ist oder damit es so weit erst gar nicht kommt? Die Sache ist womöglich einfacher als befürchtet und auch eine Frage der Reihenfolge. Von klein auf, also schon im Baby-, Krippen- und Grundschulalter müssen wir die fünf Sinne unserer Kinder fördern, quasi erziehen. Sie sollten malen, mit den Fingern und mit Pinseln, sie sollten basteln, mit Papier, Schere, Klebstoff, sie sollten unbedingt singen, jedes für sich und gemeinsam, mit ihrer eigenen Stimme, und nicht bloß Karaoke oder mit einer echten erwachsenen Person; der jedoch sollten sie beim Singen und beim Musizieren, etwa auf einer Flöte, einem Klavier, einem Akkordeon, zuhören, und sie sollten Lieder lernen, vielleicht auch selbst ein Instrument; doch das eben Genannte wird mittlerweile kaum mehr für wichtig gehalten, nicht allein wegen der Personalengpässe in den entsprechenden Einrichtungen. Kinder brauchen, Hygienebedenken zum Trotz, den Kontakt zu Tieren, die, wenn sie zu grob angefasst werden, fauchen, kratzen oder davonlaufen; das schult die taktile Empfindsamkeit und die allgemeine Sensibilität. Kinder sollten uns in den Wald folgen, dort ungiftige Beeren kosten, die raue Baumrinde fühlen, das nasse Gras, das weiche Moos. Sie sollten in Ausstellungen mitkommen, Plastiken umrunden und Gemälde betrachten – und erkennen, dass originale Bilder nicht zwei- sondern, wegen der Farbschichten, dreidimensional sind. Kurz, sie benötigen jede Menge Wirklichkeit; erst dann werden sie wissen, was das ist; unsere Freude an der schönen und unser Respekt für die weniger schöne Realität werden sie infizieren, aber sicher nicht immunisieren. – Dennoch, später, wenn unsere Kinder und Enkel die Funktionen ihrer ersten digitalen Geräte ausprobieren, haben sie die Unterschiede zwischen Off- und Onlinewelt bereits buchstäblich begriffen.
Lassen Sie mich diese Rede beenden, indem ich Ihnen ein Ereignis schildere, von dem ich mich bestätigt fühle: Als ich Anfang Januar die Berliner Müllerstraße entlangging und einen das Wetter prüfenden Blick hinauf zum trüben Himmel schickte, bemerkte ich eine Formation von sieben Nebelkrähen, die ganz allmählich, jedoch keinesfalls zufällig eine Taube einkreiste und diese nötigte, sich mehr und mehr dem Erdboden zu nähern. Ich hatte schon etwas darüber gelesen, dass die Nebelkrähen ihren Futterkonkurrentinnen, den Stadttauben, gelegentlich äußerst rabiat zusetzen, doch beobachtet hatte ich eine solche Attacke noch nie. Auf einer Holzbank neben mir saßen drei Kinder, jedes mit seinem Mobiltelefon beschäftigt. „Schaut mal hoch“, rief ich ihnen zu, „da bedrohen ein paar Krähen eine Taube!“ Wohl weil ich meinen linken Zeigefinger in die Wolken bohrte und meine Stimme so erregt klang, blickten nun auch die Kinder gen Himmel. Die Nebelkrähen stiegen ab und an ein wenig höher, weg von der Taube, allerdings bloß, um dann wieder pfeilartig auf sie hinabzuschießen, sodass die panisch Flatternde nur noch erdwärts ausweichen konnte. Die Jäger kamen der Gejagten näher und näher, bis diese quasi notlanden musste, direkt vor uns, zwischen den parkenden Autos. Als die Krähen die arme Taube dort hatten, wo sie sie offenbar von Anfang an hinbekommen wollen, begannen sie, auf ihr herumzuhacken. Die Federn der Besiegten stieben in alle Richtungen, bis sie reglos dalag, mit weit ausgebreiteten Schwingen, und die Krähen eine nach der anderen den Tatort verließen. Die Kinder hatten sich erhoben, ihre Handys weggelegt und genau wie ich den Luftkampf und das anschließende Gemetzel staunend verfolgt. Als es vorbei war, sagte eins der Drei, ein schmächtiger Junge: „Oh nein, so ein Mist, jetzt habe ich vor Schreck vergessen, ein Video davon zu machen.“
Und nun, geschätzte Zuhörerinnen und Zuhörer, danke ich Ihnen herzlich für Ihre Aufmerksamkeit.
Auch interessant

Martina Hefter
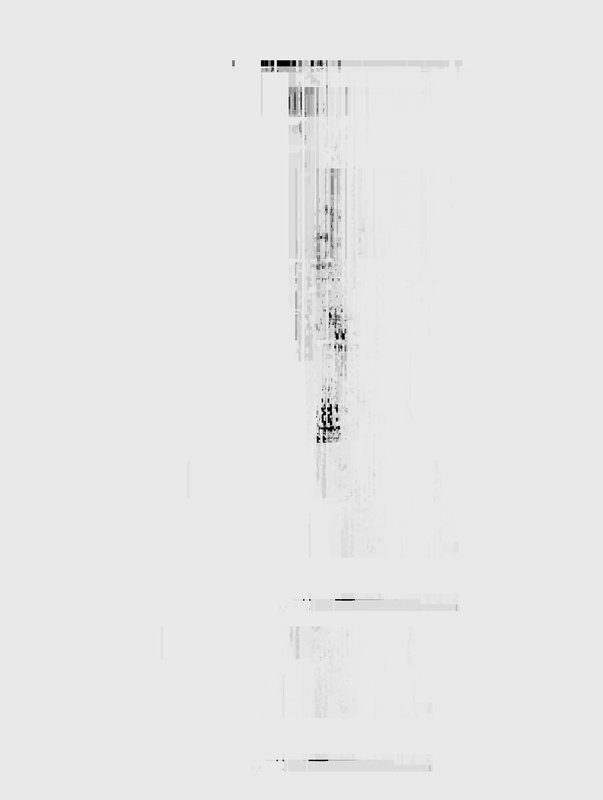
Interview mit Michał Matejko
„Ich bin davon überzeugt, dass alle großen Realitäten bereits vor uns liegen“

Landtagswahl in Thüringen

Wahrnehmungsbericht